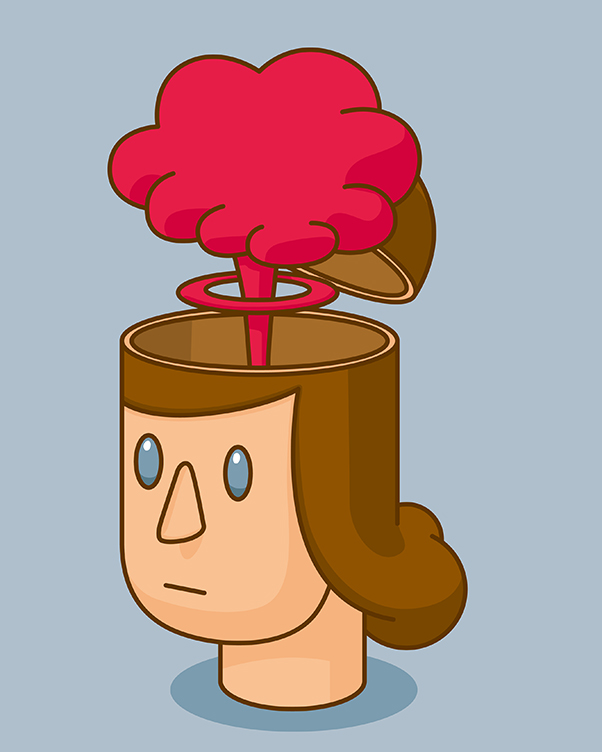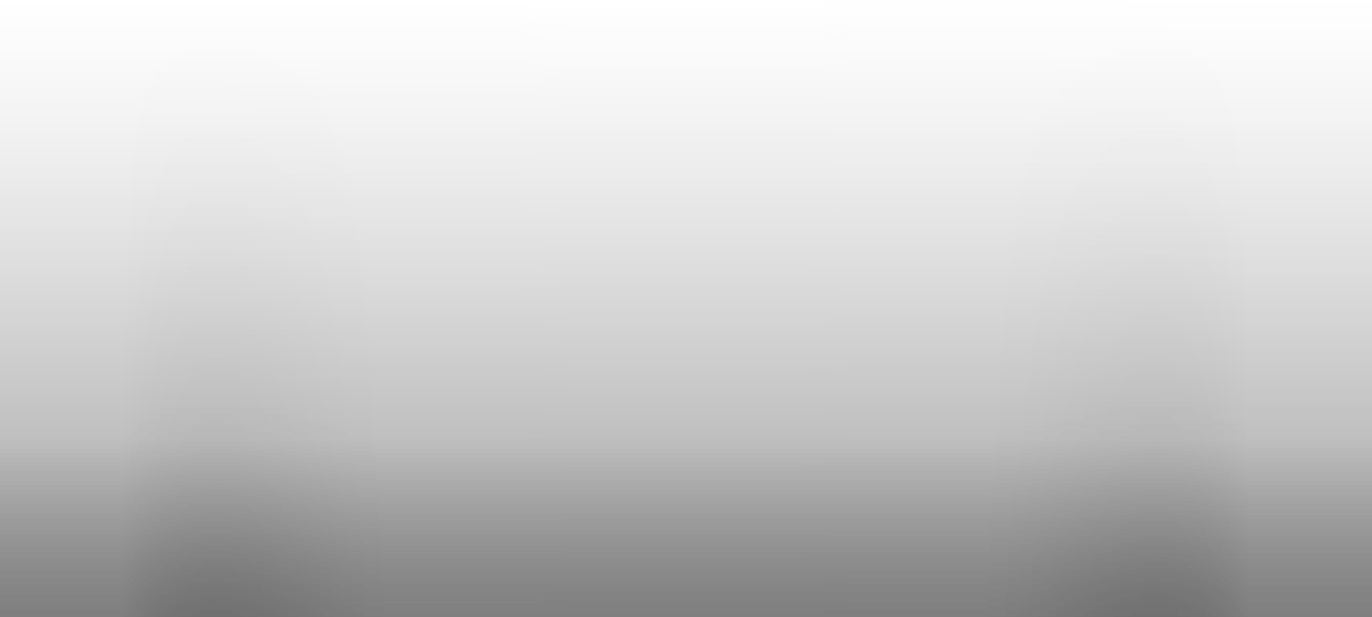
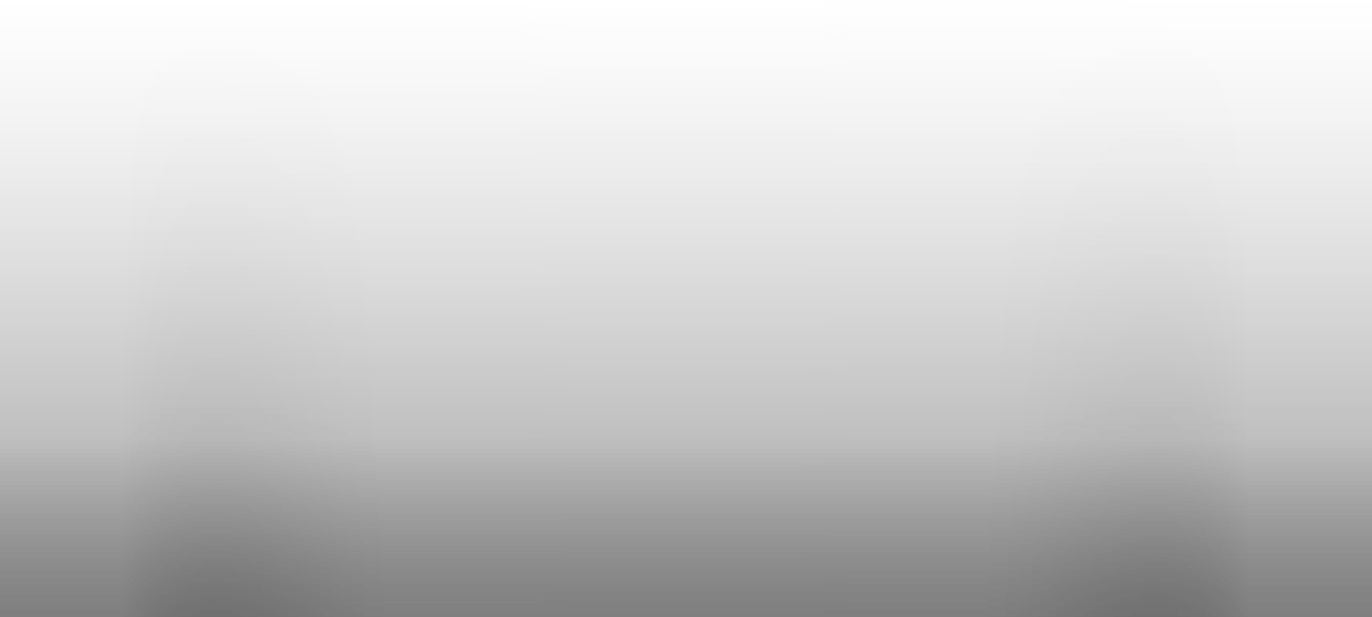


Individuelles Beschäftigungsverbot: Deine Rechte als Schwangere
SCHWANGERSCHAFT, Wissen
Ein individuelles Beschäftigungsverbot kann vom Arzt verordnet werden, wenn Gefahr für die Gesundheit der Schwangeren oder des ungeborenen Kindes droht. Wann dies der Fall ist und wie deine Rechte dabei aussehen, erfährst du hier.

Warum sieht das Mutterschutzgesetz ein individuelles Beschäftigungsverbot vor?
Während einer Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes genießt du als Mutter auch am Arbeitsplatz besonderen Schutz. Dieser wird vom Mutterschutzgesetz geregelt. Werdende Mütter sollen an ihrem Arbeitsplatz nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil gestärkt werden, damit sie ihren Beruf auch während dieser besonderen Phase gut auführen können. Ganz besonderen Wert legt das Mutterschutzgesetz darauf, dass die Gesundheit der schwangeren Frauen und die ihres ungeborenen Kindes keinen Schaden nehmen.
Für den Newsletter anmelden
Das beinhaltet unter anderem, sie vor einer möglichen Überforderung oder sie vor der Einwirkung von Gefahrenstoffen an der Arbeit oder anderer Risiken zu bewahren. Werdende Mütter sollen in der Schwangerschaft und nach der Geburt zudem weiterhin finanziell abgesichert sein und nicht mit einer plötzlichen Kündigung konfrontiert werden können. Für all das hat der Gesetzgeber Regelungen getroffen, die der Arbeitgeber und die Frauen zu ihrem Schutz und dem des Babys beachten müssen. Dazu gehört auch, dass ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden kann.

Wann wird ein individuelles Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft ausgesprochen?
Sobald eine berufstätige Frau ihren Arbeitgeber über ihre Schwangerschaft informiert hat, muss sich dieser an das Mutterschutzgesetz (MuSchG) halten. Das heißt, er muss besondere Rücksichtnahme am Arbeitsplatz walten lassen. Um das zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber eine Reihe von Schutzvorschriften verankert, unter anderem auch Beschäftigungsverbote.
Alle generellen Beschäftigungsverbote werden im Mutterschutzgesetz genau aufgeführt und benannt. Daneben gibt es aber auch noch einen weiteren Schutz für werdende Mütter: das individuelle Beschäftigungsverbot für den Einzelfall nach Paragraph 3.
Danach dürfen schwangere Arbeitnehmerinnen an ihrem Arbeitsplatz nicht weiter beschäftigt werden, wenn dadurch das Leben oder die Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet sind. Sollte dieses Beschäftigungsverbot auf dich als Schwangere zutreffen, brauchst du dafür ein Attest vom Arzt. Eine Bescheinigung deiner betreuenden Hebamme reicht dafür nicht aus. Durch das individuelle Beschäftigungsverbot soll gewährleistet werden, dass eine werdende Mutter sofort aufhören kann zu arbeiten, sobald auch nur das kleinste Risiko für sie oder das Kind auftritt. Der Hintergrund ist, dass Schwangere nicht gezwungen sind weiter zu arbeiten wegen des möglichen finanziellen Verlustes durch das geringere Krankengeld und damit vielleicht sich oder ihr Baby in Gefahr bringen.
Welche Gründe gibt es für ein individuelles Beschäftigungsverbot einer Schwangeren?
Es gibt mehrere Gründe für ein individuelles Beschäftigungsverbot:
- Gefahr einer Frühgeburt
- Mehrlingsgeburten
- Muttermundschwäche
- Rückenschmerzen
- gesundheitliche Beeinträchtigungen die auf die Schwangerschaft zurückzuführen sind
Die Grenzen zwischen Beschwerden, die durch die Schwangerschaft hervorgerufen werden und denen einer herkömmlichen Krankheit sind oft fließend. Darum wird der Arzt von Fall zu Fall entscheiden, worum es sich genau handelt. Er sollte außerdem abwägen, ob im weiteren Verlauf der Schwangerschaft Komplikationen zu befürchten sind, die ein individuelles Beschäftigungsverbot rechtfertigen. Dazu muss bei der werdenden Mutter nicht unbedingt eine akute Erkrankung vorliegen.
Wenn die Schwangere einen Job macht, der offensichtlich ihre oder die Gesundheit des Ungeborenen gefährden könnte, muss dagegen nicht extra ein individuelles Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Hier gibt es durch das Mutterschutzgesetz ganz klare Regelungen, die das Gewerbeaufsichtsamt überwacht.
Bekomme ich ein individuelles Beschäftigungsverbot bei Büroarbeit?
Ein generelles Beschäftigungsverbot für Bildschirmarbeit gibt es für Schwangere nicht. Aber die sitzende Haltung am Schreibtisch kann auf Dauer unangenehm werden oder Rückenschmerzen verursachen. Nach Prüfung des Einzelfalls (vielleicht auch durch einen Betriebsarzt der hinzugezogen werden kann) greift hier höchstens ein zeitweiliges, individuelles Beschäftigungsverbot. Der Arzt der werdenden Mutter wird dann zusammen mit dem Betriebsarzt entscheiden, ob auftretende Beschwerden schwangerschaftsbedingt sind und ob ein teilweises oder ein komplettes Beschäftigungsverbot wegen eintretender Komplikationen gerechtfertigt ist.
Bekomme ich trotzdem weiter mein Gehalt?
Während eines allgemeinen oder individuellen Beschäftigungsverbotes vor und während der Schutzfrist oder nach der Entbindung hat die Arbeitnehmerin keine finanziellen Einbußen zu befürchten. Der Arbeitgeber bezahlt mindestens ihr bisheriges Gehalt, das dem durchschnittlichen Verdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten drei Monate entspricht, in denen die Frau abgabenpflichtig gearbeitet hat. Wichtig zu wissen: Auch wenn der Arbeitgeber der werdenden Mutter wegen eines Beschäftigungsverbotes einen anderen (zumutbaren) Arbeitsplatz zuweist, darf er ihr Gehalt nicht kürzen.

Wer spricht ein individuelles Beschäftigungsverbot aus?
Das individuelle Beschäftigungsverbot kann von jedem niedergelassenen Arzt ausgesprochen werden. Oft wird dies aber dein behandelnder Gynäkologe machen. Für das Beschäftigungsverbot ist ein Attest nötig, das der Arzt mit eigenen Worten formuliert. Darin sollte möglichst genau und verständlich festgeschrieben werden, ob das Beschäftigungsverbot jegliche Tätigkeit am Arbeitsplatz verbietet. Manchmal kann die Schwangere leichtere Arbeiten übernehmen oder zumindest weniger Stunden am Tag arbeiten. In diesen Fällen könnte der Arbeitgeber ihr einen anderen, weniger gefährdenden Arbeitsplatz zuweisen.
Wie lange dauert ein individuelles Beschäftigungsverbot und was umfasst es?
Das Attest des Arztes gibt darüber Auskunft, warum und in welchem Umfang eine weitere Beschäftigung eine Gefahr für Mutter und Kind darstellt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein totales (dabei ist jede Tätigkeit untersagt) oder ein partielles (dabei sind nur bestimmte Tätigkeiten oder diese auf eine bestimmte Zeit untersagt) Beschäftigungsverbot zu attestieren. Ein Beispiel für ein partielles Beschäftigungsverbot sind die Begrenzung der Arbeitszeit auf eine gewisse Stundenzahl pro Tag oder Woche oder eine Begrenzung der Zuständigkeiten im Job.
Wichtig zu wissen: Nicht immer übernehmen die Krankenkassen die Kosten für das Attest. Hier solltest du bei deiner Krankenkasse nachfragen.
Der Arbeitgeber muss sich in jedem Fall an das einmal ausgesprochene Beschäftigungsverbot halten. Hat er jedoch gewisse Zweifel an dessen Richtigkeit, kann er eine Nachuntersuchung verlangen. Welcher Arzt diese Untersuchung vornimmt, bestimmt jedoch wiederum die Schwangere. Du kannst in dieser Situation also ruhig eine Untersuchung durch den Werksarzt ablehnen. Die Kosten für die Nachuntersuchung hat der Arbeitgeber zu tragen.
Was ist für mich als Schwangere besser: ein Beschäftigungsverbot oder eine normale Krankschreibung?
Das ist wirklich von Fall zu Fall zu entscheiden. Bei einer Erkältung wird der Arzt auch in der Schwangerschaft zunächst eine normale Krankschreibung ausstellen. Ist es allerdings so, dass du dich auch nach sechs Wochen noch nicht gut fühlst, weil du dich während der Schwangerschaft einfach schlechter auskurierst, kannst du den Arzt bitten ein zeitweiliges, individuelles Beschäftigungsverbot zu attestieren. Dann erhältst du nicht nur das Krankengeld, das niedriger ist als dein normales Gehalt, sondern wieder die vollen Bezüge.
Bist du jedoch beim Auftreten der Schwangerschaft arbeitslos gemeldet, ist wiederum die Krankschreibung vorteilhafter. Wird ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, stellt das Arbeitsamt nämlich sofort die Zahlung des Arbeitslosengeldes ein. Denn diese Leistung darf nur bezogen werden, wenn du als Arbeitssuchende grundsätzlich vermittelt werden könntest. In diesem Fall müsstest du mit finanziellen Einbußen rechnen, was eine normale Krankschreibung vorteilhafter macht.
Gilt das individuelle Beschäftigungsverbot auch nach der Geburt?
Auch nach der Geburt kann ein individuelles Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Das geschieht zum Beispiel, wenn nach der Mutterschutzfrist von acht Wochen bei der jungen Mutter weiterhin eine verminderte Leistungsfähigkeit besteht, die auf die Geburt zurück zu führen ist. Maximal bis zum sechsten Monat nach der Geburt kann der Arzt dann das Beschäftigungsverbot durch Attest bestätigen. Aus dem Attest sollte klar ersichtlich sein, inwiefern die Leistungsfähigkeit der Mutter eingeschränkt ist, welche Tätigkeiten ihr zuzumuten wären und wie lange dieses Beschäftigungsverbot gelten soll.
Bilder: GettyImages (2); Unsplash (2)