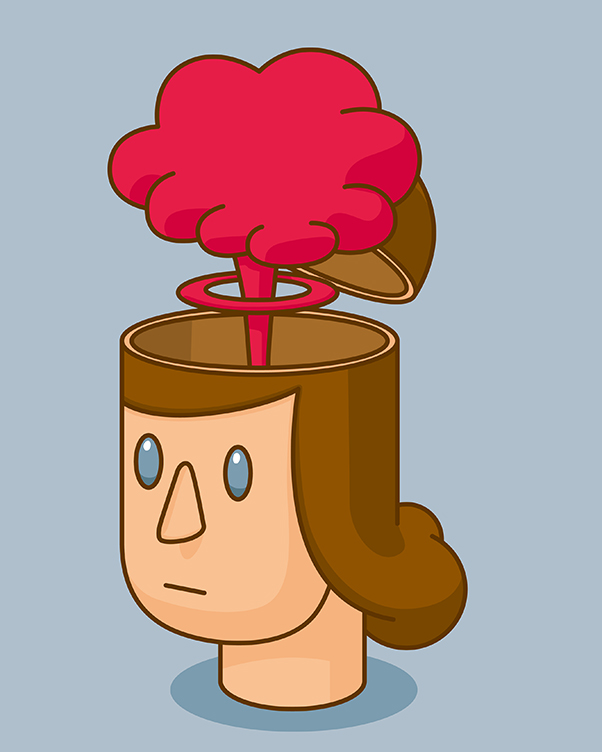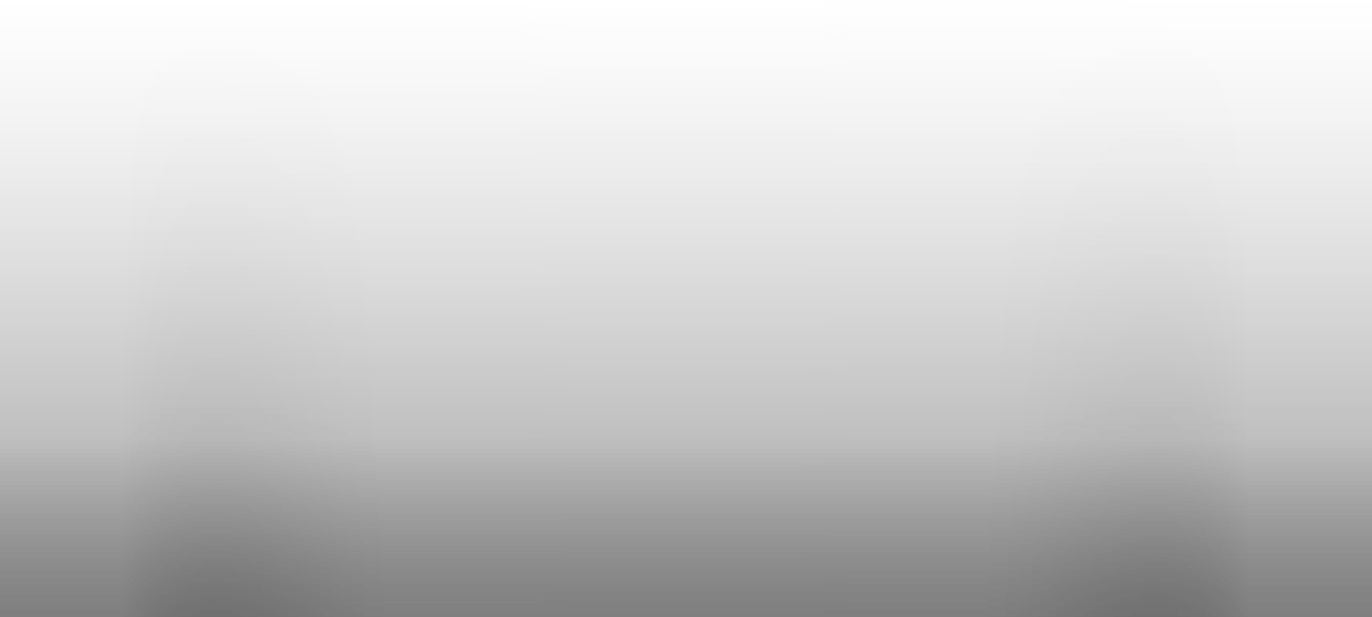
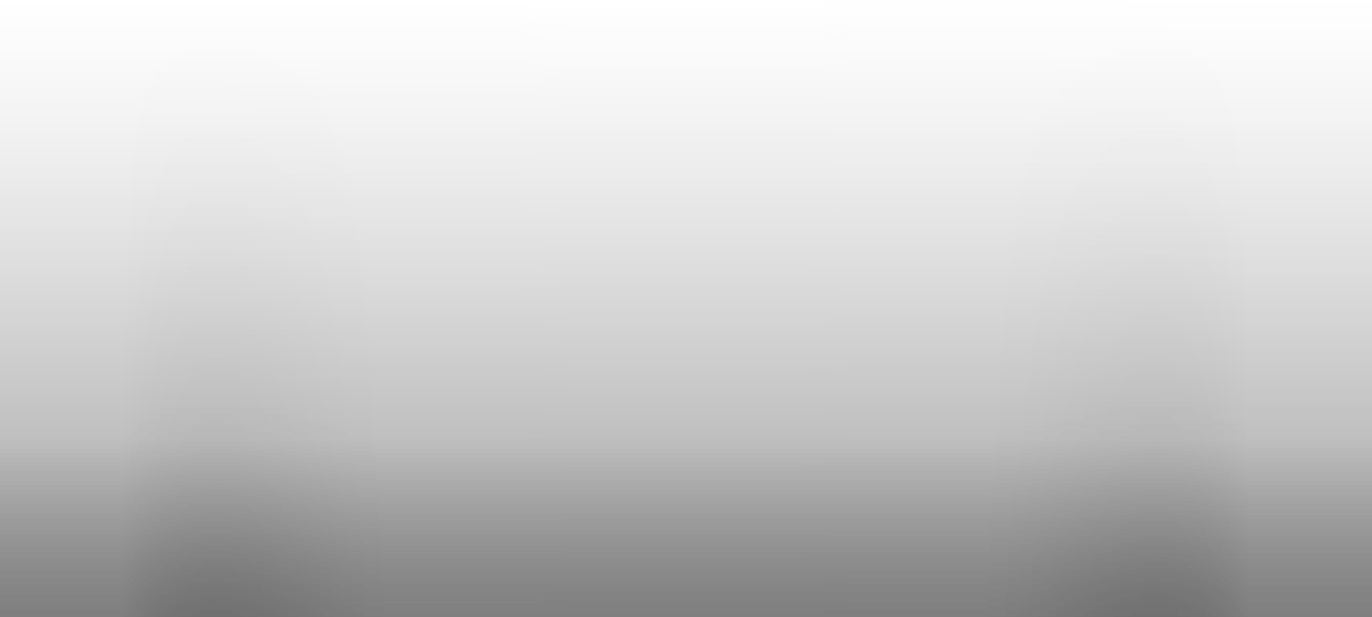


Erfahrungsbericht: Drei Monate Hebammen-Praktikum im Kreißsaal
Menschen, MUM, SCHWANGERSCHAFT
Unsere Autorin hat ein Praktikum im Kreißsaal gemacht. Was sie in den drei Monaten erlebt hat, welchen Eindruck sie vom Klinikalltag bekommen hat und warum sie für die Erfahrungen aus dieser Zeit dankbar ist, schildert sie in einem sehr persönlichen Beitrag.
Von Ragnhild Deschner
Ich habe drei Monate im Kreißsaal als Praktikantin gearbeitet. Seit meiner ersten Schwangerschaft begleitet mich der Wunsch, Hebamme zu werden. Diesem Wunsch bin ich einen kleinen Schritt näher gekommen. Zugegeben, bei dem ersten Geburtsvorgang ist mir schwarz vor Augen geworden und ich musste mich im Pausenraum hinlegen, bevor irgend etwas passiert war (die Frau hatte lediglich zu pressen begonnen, von dem Baby hatte man noch nichts gesehen). Auch bei meinem ersten Kaiserschnitt musste ich den OP verlassen. Zum Glück wurde das aber schnell besser und meine erste vollständige Geburt war magisch, emotional und faszinierend – alles auf einmal. Ab dem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr und ich ging zu jeder Geburt mit, zu der ich mitkommen durfte. Wenn das Baby erst geboren war, kamen mir oft Tränen der Rührung, spätestens immer dann, wenn der Vater des Kleinen eine Träne verdrücken musste.
In dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, finden jährlich über 2.000 Geburten statt und es ist eine Kinderklinik angeschlossen. Sehr viele Frauen mit Risikoschwangerschaften werden dort behandelt. Die Risiken reichen von Schwangerschaftsdiabetes über Beckenendlage bis zur Schwangerschaftsvergiftung. Auch viele Geburtseinleitungen fanden während meiner Zeit dort statt. Meine Vorstellung von schöner und selbstbestimmter Geburt musste ich im Klinikalltag sehr schnell über den Haufen werfen.

„Es gibt zu wenig Hebammen, zu wenig Kreißsäle, zu wenig Geld.“
Ganz zu Anfang kam mir der Kreißsaal wie eine Abfertigungsstation vor. Schnell, schnell, pressen, pressen. Es wurde Oxytocin zu jedem Zeitpunkt verabreicht, zu dem es vorangehen sollte, ganz zu schweigen von der Standardgabe nach der Geburt, damit die Plazenta bloß nicht zu lange auf sich warten ließ. Oxytocin ist das Kuschelhormon, das während der Geburt und auch danach massenhaft im Körper der Mutter ausgeschüttet wird und dem gesamten Geburtsvorgang enorm hilft. Viele Geburten wurden in meinen Augen und in Ermangelung eines besseren Wortes „abgewickelt“. Betrachtet man die momentane Lage in der Pflege, ist das verständlich. Es gibt zu wenig Hebammen, zu wenig Kreißsäle, zu wenig Geld. Da kann man schlecht 30 Stunden warten, bis eine Erstgebärende völlig natürlich und in ihrem eigenen Tempo ihr Kind zur Welt bringt. Man braucht den Kreißsaal, weil auf dem Flur schon die nächsten drei Frauen mit Wehen warten.
Dazu muss ich sagen, dass ich persönlich Hausgeburten sehr viel abgewinnen kann und eher auf dem alternativen medizinischen Weg unterwegs bin. Es gibt sinnvolle und sinnlose Interventionen und die Geburten, die ich völlig ohne Interventionen erlebt habe, kann ich an einer Hand abzählen. Natürlich gab es auch wunderschöne Geburten. Zwillinge oder ein Baby in Beckenendlage natürlich auf die Welt kommen zu sehen waren großartige Erlebnisse. Das spricht für das Krankenhaus, denn in den meisten Fällen enden Zwillings- und Beckenendlagen-Schwangerschaften in einem Kaiserschnitt. Auch das ist natürlich der katastrophalen Lage in der Pflege geschuldet!
„Ich erinnere mich nicht mehr an jede Geburt, die ich begleitet habe.“
Für jedes Paar ist die Geburt seines Kindes einmalig und einzigartig. Und so dachte auch ich, dass ich mich bestimmt an jede Geburt, jede Mutter erinnern würde. Das stellte sich schnell als Trugschluss heraus. So sehr mir die Geburten meiner eigenen Kinder ins Gedächtnis gebrannt sind, so sehr verschwimmen die Erinnerungen an die unterschiedlichen Frauen, die ich betreut habe. Natürlich sind mir einige besonders schöne, aber auch besonders schwierige und komplizierte Geburten im Kopf geblieben, aber ich würde lügen, wenn ich sagte, ich würde mich an mehr als 15 Geburten erinnern.
Es ist im Endeffekt eben doch nur ein Job. Zwar einer, bei dem ich meinem Gegenüber in seiner intimsten, verletzlichsten, anstrengendsten und außergewöhnlichsten Lebensphase begegne, aber dies in einer so unzähligen Menge, dass es unmöglich ist, sich an alle zu erinnern. Trotzdem fand ich den Moment, in dem das Köpfchen endlich im Ansatz zu sehen war (im Englischen übrigens „crowning“ genannt – wie passend!), jedes Mal total faszinierend, erleichternd und unglaublich.

„Geburten rentieren sich leider für kein Krankenhaus, das wirtschaftlich sein will.“
Ich wurde von einem großartigen Team aus Hebammen und Ärzten angeleitet, doch auch in der Belegschaft konnte man hin und wieder die angespannte Situation in der Pflege spüren. Geburten rentieren sich leider für kein Krankenhaus, das wirtschaftlich sein und schwarze Zahlen schreiben will. Deswegen schließen immer mehr Kreißsäle und die Hebammen müssen bei der Verwaltung mehrmals nachfragen, bevor ein längst überholtes oder defektes Gerät erneuert wird. Geschweige denn, dass Gehälter regelmäßig angepasst würden. Es gab Schichten, zu denen nur eine Hebamme gearbeitet hat, weil zwei andere krank geworden waren und man keinen Ersatz fand. Normalerweise sind drei Hebammen in einer Schicht und auch das kann manchmal zu wenig sein, wenn Notfälle reinkommen oder eben mehr als drei Frauen in einer ähnlich dringenden Geburtsphase sind.
Hebammen haben extrem viel Verantwortung, was viel zu selten gewürdigt wird. Aber auch die Gebärenden selbst holten mich schnell auf den Boden der Realität zurück. Natürlich gab es zahlreiche Frauen, die sich vor der Geburt Gedanken gemacht hatten, die wussten, wie der Ablauf ungefähr sein würde. Viel mehr Frauen aber, die ich erlebt habe, erschienen gänzlich unwissend im Krankenhaus, wollten ihr Baby bekommen, ein paar Tage dort bleiben und dann nach Hause gehen.
Ich war oft fassungslos über die Unwissenheit dieser Frauen sowohl was den Geburtsvorgang betrifft als auch ihren eigenen Körper. Eine Frau, bei der die Geburt eingeleitet werden sollte, wurde aufgefordert, davor etwas spazieren zu gehen. Da fragte sie, ob es denn nicht passieren könne, dass ihr das Baby draußen auf den Boden plumpse. Solche und ähnliche Fragen gab es oft von Gebärenden. Eine Hebamme erzählte, dass sie regelmäßig den Spiegel hervorhole, um einer Frau zu erklären, was Klitoris, Vulva und Schamlippen seien. Und dass sie am liebsten Projekte leiten würde, bei denen Mädchen und junge Frauen umfassend informiert und aufgeklärt würden.
„Während meiner Praktikumszeit ist mir aufgefallen, wie still der Kreißsaal oft war.“
In unserer hippen, aufgeklärten Bildungsbürgertumsblase mit Geburtsfotografie, Geburtsplan und Wolle-Seide-Erstausstattung kann man sich dieses Unwissen nur schwer vorstellen. Wahrscheinlich war ich auch deshalb schockiert von der Realität. Während meiner Praktikumszeit ist mir aufgefallen, wie still der Kreißsaal oft war, obwohl er voll belegt war. Was ich als befremdlich empfand, machte angesichts der hohen PDA-Rate in „meinem“ Krankenhaus Sinn: Da hier über 80 Prozent der Frauen eine PDA (Periduralanästhesie) bekamen, empfanden sie weniger Schmerz und mussten nicht so brüllen, wie ich es bei meinen beiden Geburten getan hatte. Ich will die PDA nicht schlecht reden, aber für mein (sehr subjektives) Empfinden gehört Schmerz zur Geburt dazu. Dabei erlebte ich den Schmerz nicht als negativ, denn jede Wehe, jedes Aufbäumen brachte mich und bringt jede andere Frau dem Kind näher.
„Die Kunst ist es, als Hebamme immer menschlich zu bleiben.“
Mein Praktikum hat drei Monate gedauert und anfangs hatte ich Berührungsängste mit den Frauen „unter Geburt“. Ich wusste nicht, ob sie angesprochen werden wollten, ob sie forsch reagieren würden (was in dem Zustand völlig normal ist!). Meine Einschätzung des richtigen Moments für die Ansprache verbesserte sich aber mit jeder Frau, und schnell bot ich meine Hand, Wasser und ermutigende Worte zu jedem Zeitpunkt an. Ich durfte Neugeborene messen und wiegen und in dieser Welt willkommen heißen. Ich durfte den frischgebackenen Müttern und Vätern sagen, wie großartig sie das gemacht hatten, wie stolz sie auf sich sein könnten. Im Krankenhaus sucht man sich seine „Kunden“ nicht aus und so sind auch oft Welten aufeinandergeprallt, die sich im normalen Leben nicht mal tangiert hätten. Trotzdem habe ich jeden immer freundlich und mit Respekt behandelt. Aber natürlich gibt es Paare, bei denen man sich mehr mitfreut als bei anderen.
Die Kunst ist es, als Hebamme immer menschlich zu bleiben, was mir meine Kolleginnen sehr schnell klargemacht haben und was mir laut meinem Praktikumszeugnis ganz gut gelungen ist. Ob es nun die viertgebärende 18-Jährige ist, die unfreundliche und emotionslose 40-Jährige, die nicht stillen wollte, weil sie rauchte, oder der latent aggressive Ehemann, der genervt davon war, dass er wegen Corona im Kreißsaal bei seiner Frau bleiben musste und nicht noch einmal rausgehen konnte …
Leicht bestürzt war ich über die immer wiederkehrende Sprachbarriere. Wir hatten mehr als eine Frau, die kein Wort Deutsch sprach, obwohl sie schon ihr viertes oder fünftes Kind in unserem Krankenhaus zur Welt brachte. Diese Frauen waren oft sehr höflich, aber natürlich auch völlig verunsichert, weil sie einfach nicht verstanden, was wir von ihnen wollten. Da der Mann aufgrund der Corona-Regeln nicht von Anfang an bei seiner Frau sein durfte, musste er für jede noch so kleine Anweisung angerufen werden, damit er übersetzen konnte. Ich versuchte oft, mit Händen und Füßen zu kommunizieren oder zumindest ein ermunterndes Lächeln zu schenken. Ich könnte noch viel mehr über meine Zeit im Kreißsaal schreiben.
„Insgesamt hat mich das Praktikum unheimlich bereichert.“
Es gibt noch so viel, was ich schwangeren Frauen mit auf den Weg geben möchte, obwohl ich dafür bisher noch gar nicht richtig qualifiziert bin. Und doch habe ich das Gefühl, dass mich meine Intuition und mein Verständnis für mein Gegenüber zu einer guten Hebamme machen würden. Insgesamt hat mich das Praktikum unheimlich bereichert. Der Drahtseilakt – 40 Stunden die Woche im Schichtdienst zu arbeiten und selbst zwei kleine Kinder zu haben – ist mir zwar gelungen, aber ich war doch die ganze Zeit über sehr erschöpft. Vielleicht muss ich den Wunsch noch auf die lange Bank schieben und warten, bis meine Kinder etwas selbstständiger sind. Bewerben werde ich mich dieses Jahr trotzdem. Ob ich das Studium dann wirklich beginne, muss ich noch abwägen. Zum Glück weiß ich auch, was ich nicht machen möchte, nämlich 40 Stunden in einem derart großen Krankenhaus arbeiten. So wunderbar mein Praktikum auch war, möchte ich als Hebamme doch selbstbestimmter sein, genauso, wie ich für selbstbestimmte Geburten plädiere.
Bilder: gettyimages